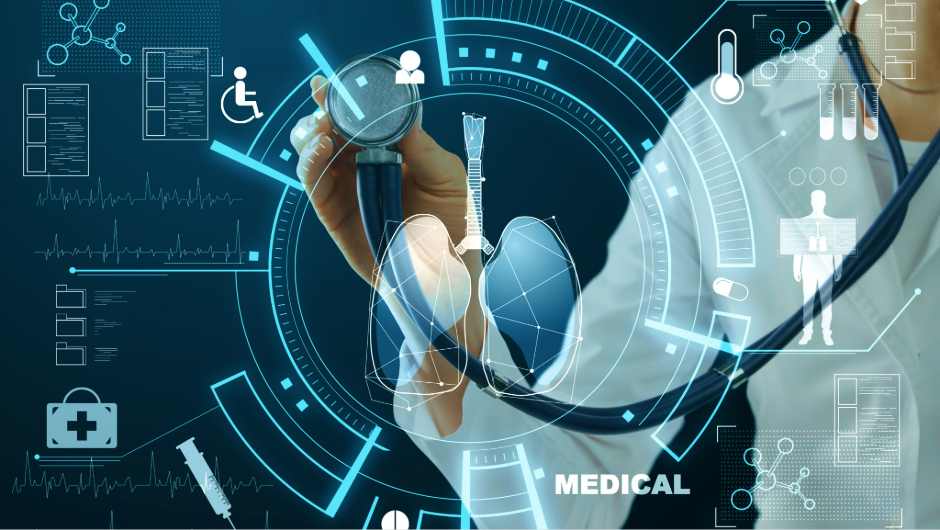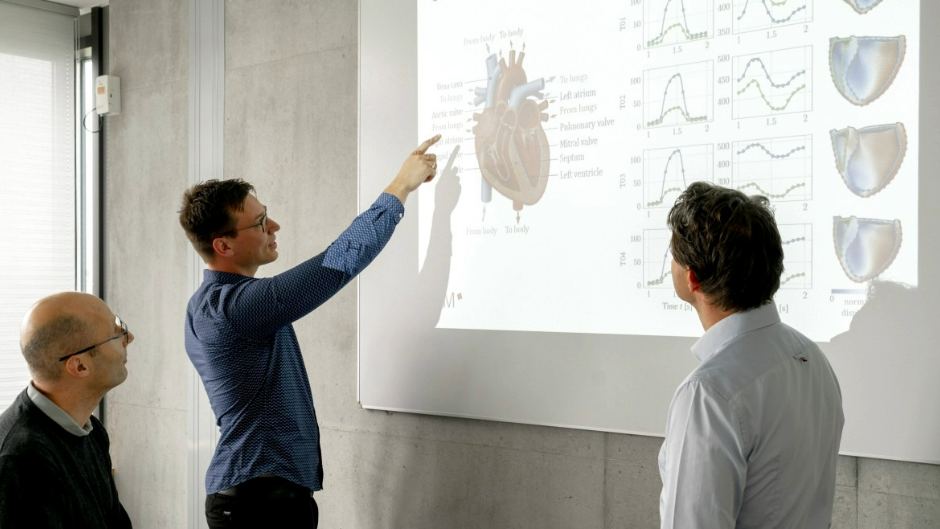RWTH-Forschende vom Lehrstuhl für Kommunikationswissenschaft befragten 1.100 Personen zu diversen KI-Szenarien.
Nimmt die Gesellschaft Künstliche Intelligenz (KI) als Chance oder als Risiko wahr? Wann ist KI kompatibel mit unseren Werten? Eine repräsentative Studie von Forschenden des Lehrstuhls für Kommunikationswissenschaft der RWTH Aachen zur Wahrnehmung von KI in der Bevölkerung gibt einen umfassenden Überblick über die öffentliche Bewertung unterschiedlichster KI-Anwendungen, vom autonomen Fahren über den Einsatz in der Medizin bis hin zur Kunst oder zum Militär. Befragt wurden 1.100 repräsentativ ausgewählte Personen in Deutschland zu insgesamt 71 konkreten KI-Szenarien. Bewertet wurden die erwartete Eintrittswahrscheinlichkeit der Technologie, das wahrgenommene Risiko und der persönliche Nutzen von KI in diesen Szenarien.
Das Ergebnis: Viele KI-Szenarien gelten zwar als wahrscheinlich, aber bei weitem nicht als wünschenswert. Anwendungen in der Gesundheitsversorgung oder zur Unterstützung älterer Menschen wurden als nützlich und vergleichsweise sicher wahrgenommen. KI-Anwendungen im militärischen Kontext, bei Überwachung oder autonomen Entscheidungen über Leben und Tod wurden als unerwünscht und negativ bewertet.
Die Mechanismen der Meinungsbildung war auch Gegenstand der Forschung. „Die öffentliche Meinung zu KI lässt sich erstaunlich gut über eine einfache Risiko-Nutzen-Abwägung erklären“, sagt Studienleiter Dr. Philipp Brauner vom RWTH-Lehrstuhl für Kommunikationswissenschaft. „Spannend ist, dass nicht die Risiken, sondern der empfundene Nutzen das stärkere Gewicht bei der Bewertung hat.“
Ebenso zeigt die Studie: Gerade Menschen mit weniger technischem Verständnis sehen in KI-Anwendungen eher Risiken und seltener ihren Nutzen. „Je besser Menschen verstehen, wie KI funktioniert, desto besser können sie KI-Anwendungen ergebnisoffen und differenziert einordnen. Für uns ein klarer Appell für mehr Bildung und Aufklärung, idealerweise schon in der Schule“, so Brauner.
Ein Beispiel für den oft widersprüchlichen Umgang mit KI liefert die Bewertung der Aussage „KI wird alles über mich wissen“: Diese Aussage wurde zwar als nicht wünschenswert bewertet, gleichzeitig teilen viele Menschen jedoch persönliche Daten freiwillig in großer Detailtiefe in sozialen Medien oder mit Chatbots. „Ein Großteil dieser Daten fließt inzwischen in das Training neuer KI-Modelle ein. Das erinnert an das sogenannte „Privacy Paradox“ aus der Online-Datenschutzforschung: Menschen äußern Sorgen, verhalten sich aber oft genau gegenteilig“, erklärt Brauner.
Die Studie legt offen, dass es bei der Einführung von KI-Anwendungen von der Entwicklung in die Nutzung entscheidend ist, Kompetenzen aufzubauen, die es erlauben, technologische Innovationen zu bewerten, falsche Erwartungen und fehlerhaftes Wissen zu identifizieren und Vor- und Nachteile für die gesellschaftliche Integration von KI-Anwendungen abzuwägen. „Wer KI-Anwendungen einführen oder diskutieren will, sei es in Politik, Forschung oder Wirtschaft, der sollte ergebnisoffen vor allem den wahrgenommenen Nutzen kommunizieren. Nur wenn KI als nützlich empfunden wird, steigen Akzeptanz und Unterstützung für eine mit unseren Werten abgestimmte Nutzung von KI-Technologien in der Bevölkerung“, konstatiert Brauner.
Originalpublikation
Philipp Brauner, Felix Glawe, Gian Luca Liehner, Luisa Vervier, Martina Ziefle: Mapping public perception of artificial intelligence: Expectations, risk–benefit tradeoffs, and value as determinants for societal acceptance. in Technological Forecasting and Social Change, Volume 220 (2025).
Quelle: © RWTH Aachen University
Symbolbild: cherdchai / AdobeStock