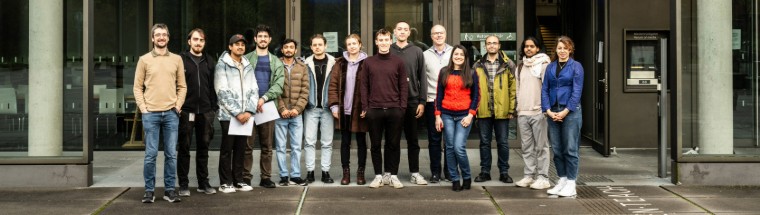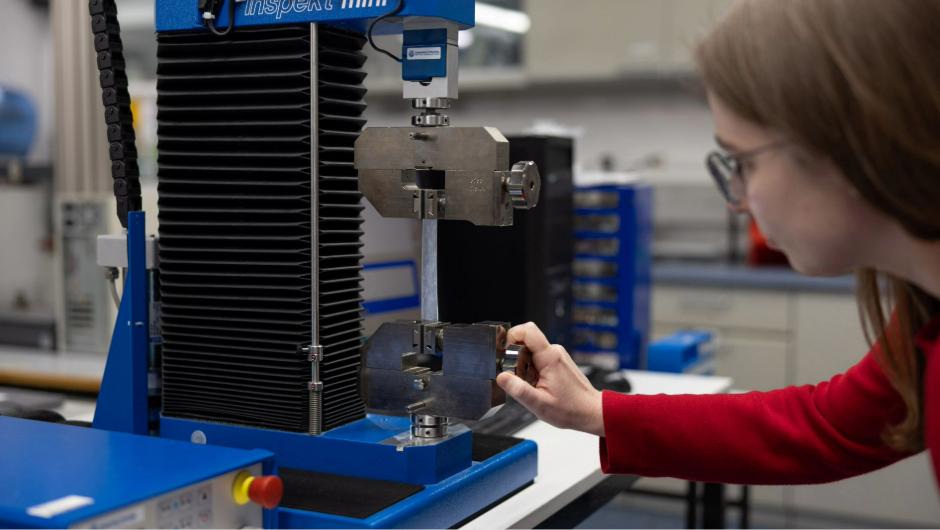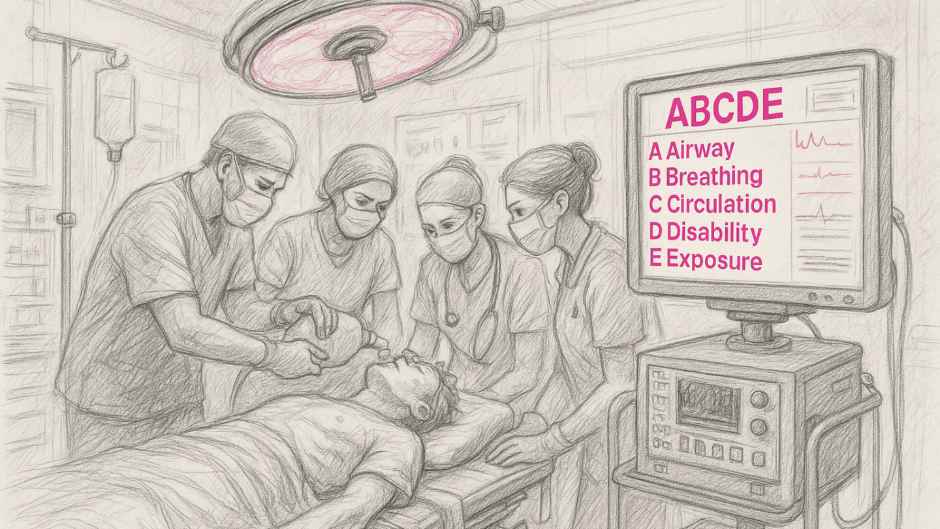Interoperabilität im Gesundheitswesen ist für Healthcare-Akteure mit Weitblick der Kernpunkt. Notwendig sind sektorenübergreifend einheitliche, verbindliche Vorgaben für alle. Herausforderungen der Digitalisierung sind allein mit dem Schreiben neuer Gesetze, Regularien und Spezifikationen nicht zu lösen, man muss sie auch implementieren. Die internationale FHIR-Community macht es vor. Aspekte für einen flächendeckend harmonisierten Datenaustausch erörtert Simone Heckmann, Geschäftsführerin / CEO, Gefyra GmbH, im Interview mit dem Krankenhaus IT Journal.
Bricht mit der Einführung von HL7 FHIR eine neue Ära der Interoperabilität im Gesundheitswesen an?
Simone Heckmann: Ja, davon bin ich überzeugt! Mit HL7 FHIR steht uns erstmals ein moderner internationaler Standard zur Verfügung, der das gesamte Gesundheitswesen berücksichtigt (ambulante und stationäre Versorgung, Forschung, öffentlicher Gesundheitsdienst, Kostenträger-Kommunikation, regulatorischer Datenaustausch etc.) alle gängigen Formen des Datenaustausches beherrscht (nachrichtenbasierte, dokumentenbasierte sowie abfragebasierte Kommunikation), aber auch das Bedürfnis der Industrie nach einfachen, modernen, webbasierten Lösungen erfüllt. Damit haben wir die Möglichkeit, den Datenaustausch im Gesundheitswesen flächendeckend zu harmonisieren und wegzukommen von kleinteiligen Insellösungen.
Wie weit akzeptieren Healthcare-Hersteller Interoperabilität? Welche Benefits gibt es für die Industrie?
Simone Heckmann: Es kommt drauf an. Es gibt immer Hersteller, die Daten haben und Hersteller, die Daten brauchen. Primärsystem-Hersteller, insbesondere diejenigen, die monolithische Systeme (“alles aus einer Hand”) anbieten, sind der Interoperabilität gegenüber meist zurückhaltend, Subsystem-Hersteller hingegen sind auf Interoperabilität angewiesen und sehen in FHIR eine willkommene Lösung, die zu modernen Architekturen passt. Ich habe jedoch immer häufiger auch mit Monolithen zu tun, die für die interne Kommunikation zwischen ihren verschiedenen Modulen - die ja historisch betrachtet häufig auch nichts anderes sind, als Subsysteme von aufgekauften Herstellern - eine nachhaltige und flexible Lösung suchen und auf diesem Wege ebenfalls bei HL7 FHIR landen.
Muss Interoperabilität der Gesetzgeber vorschreiben? Oder regelt das der Markt?
Simone Heckmann: Ich stehe der Idee, so etwas den Markt regeln zu lassen, kritisch gegenüber. Oft hat dies zur Konsequenz, dass der Lösungsvorschlag des Herstellers mit der größten Marktmacht gewinnt, unabhängig davon, ob es sich dabei um die technisch ausgereifteste bzw. “beste” Lösung handelt (man denke an “Betamax vs. VHS”). Weiterhin stehen wir vor der Herausforderung, dass das Gesundheitswesen
bei weitem nicht so stark globalisiert und internationalisiert wäre, als dass wir internationale Standards ohne weiteres Zutun in Deutschland nutzen könnten. Ganz im Gegenteil: Flexibilität und Offenheit für (nationale) Anpassungen gehören zu den grundlegendsten Eigenschaften internationaler Standards. Dies wiederum erfordert jedoch eine nationale Vereinheitlichung dieser Anpassungen. Biegt sich jeder Hersteller den Standard nach eigenem Ermessen zurecht, kann die Interoperabilität innerhalb Deutschlands nicht gewährleistet werden.
Ich sehe es als ganz wichtige Aufgabe des Gesetzgebers, hier klare Zuständigkeiten zu schaffen, für bundesweit und sektorenübergreifend einheitliche Vorgaben zu sorgen und diese für alle verbindlich zu machen.
Simone Heckmann, Geschäftsführerin / CEO,
Gefyra GmbH, Leiterin Technisches Komitee FHIR
(HL7 Deutschland e.V.), FHIR Core Team Member:
„Wir stehen bei der Digitalisierung des
Gesundheitswesen vor enormen Herausforderungen,
die allein mit dem Schreiben neuer Gesetze, Regularien
und Spezifikationen nicht gelöst werden können;
man muss sie auch implementieren!“
Wie weit sind Krankenhäuser technologisch, organisatorisch und personell auf Interoperabilität vorbereitet? Was ist zu optimieren?
Simone Heckmann: Kompetenz zum Thema FHIR aufzubauen, auch wenn aktuell in den Kliniken zum Teil noch keine FHIR-Schnittstellen im Einsatz sind, ist das Gebot der Stunde! FHIR ist kein Zauberwort, das - dreimal in den Kommunikationsserver gesprochen - alle Interoperabilitätsprobleme auf magische Weise löst. Wie eingangs gesagt: FHIR ist eine Technologie, die auf viele verschiedene Weisen genutzt werden kann und nicht alle davon sind untereinander kompatibel. Ein Hersteller muss wenig tun, um sein System als “FHIR konform” bezeichnen zu können. Für Entscheider in den Kliniken ist es wichtig, die richtigen Fragen stellen, Anforderungen präzisieren und Spezifikationen lesen zu können, um beurteilen zu können, ob ein System, das FHIR-Konformität verspricht, tatsächlich den eigenen Interoperabilitäts-anforderungen genügt.
Welche neuen Risiken für Sicherheit und Datenschutz von Gesundheitsdaten bringt Interoperabilität? Wie lässt sich die Sicherheit von Gesundheitsdaten sicherstellen?
Simone Heckmann: Die Verwendung von HL7 FHIR hat beim Thema Datenschutz und Datensicherheit einen entscheidenden Vorteil: Das Rad muss nicht neu erfunden werden. FHIR setzt auf die Verwendung von etablierten und erprobten IT-Standards, wie zum Beispiel das HTTP-Protokoll mit TLS-Verschlüsselung, oder den OAUTH2-Standard zur Benutzerauthentifikation. Das hat den Vorteil, dass die Entwickler auf langjährige Erfahrungen anderer Branchen und fertige Softwarebibliotheken zurückgreifen können, die gegen Angriffe gehärtet sind.
Ist Interoperabilität als Standardisierungsprozess Innovationshemmnis oder Anschub für technische Weiterentwicklungen?
Simone Heckmann: HL7 FHIR basiert auf dem Baukastenprinzip. Es gibt verschiedene Informationsbausteine, um z.B. Patientenstammdaten, Diagnosen, Prozeduren oder Messwerte abzubilden. Diese können dann in unterschiedlichen Kontexten immer wieder verwendet werden, z.B. um die Diagnosen eines Patienten für ein Subsystem abrufbar zu machen oder die Patientenstammdaten an ein Messgerät zu übermitteln oder um daraus einen strukturierten Entlassbrief zu erstellen. Einmal implementiert, kann eine Vielzahl von Prozessen unterstützt werden, ohne dass dafür ein erheblicher Mehraufwand erforderlich ist. Weiterhin ermöglicht die abfragebasierte Kommunikation erstmals die einfache Integration von leichtgewichtigen, webbasierten und mobilen Applikationen in die Krankenhaus-Umgebung. Zum Beispiel um wichtige Patienteninformationen auf die Smartphones der Ärzte zu bringen, oder um moderne, webbasierte Lösungen standardisiert in KIS-Systeme zu integrieren (“Fremdaufruf ”). Damit sind Krankenhäuser künftig schneller in der Lage, innovative Lösungen in ihre bestehende Umgebung integrieren und den Anwendern zur Verfügung stellen zu können.
Ist Interoperabilität als Standardisierungsprozess Innovationshemmnis oder Anschub für technische Weiterentwicklungen?
Simone Heckmann: HL7 FHIR basiert auf dem Baukastenprinzip. Es gibt verschiedene Informationsbausteine, um z.B. Patientenstammdaten, Diagnosen, Prozeduren oder Messwerte abzubilden. Diese können dann in unterschiedlichen Kontexten immer wieder verwendet werden, z.B. um die Diagnosen eines Patienten für ein Subsystem abrufbar zu machen oder die Patientenstammdaten an ein Messgerät zu übermitteln oder um daraus einen strukturierten Entlassbrief zu erstellen. Einmal implementiert, kann eine Vielzahl von Prozessen unterstützt werden, ohne dass dafür ein erheblicher Mehraufwand erforderlich ist. Weiterhin ermöglicht die abfragebasierte Kommunikation erstmals die einfache Integration von leichtgewichtigen, webbasierten und mobilen Applikationen in die Krankenhaus-Umgebung. Zum Beispiel um wichtige Patienteninformationen auf die Smartphones der Ärzte zu bringen, oder um moderne, webbasierte Lösungen standardisiert in KIS-Systeme zu integrieren (“Fremdaufruf ”). Damit sind Krankenhäuser künftig schneller in der Lage, innovative Lösungen in ihre bestehende Umgebung integrieren und den Anwendern zur Verfügung stellen zu können.
Wie ist „Kapitalismus – Sozialismus in der Datenwelt“ zu verstehen? Welche Sichtweisen und Perspektiven zeigen sich?
Simone Heckmann: „Daten sind das neue Öl”. Unterwirft man Daten den Gesetzmäßigkeiten des freien Marktes, dann werden sie auch wie Öl gehandelt, d.h. eine kleine, aber mächtige Elite derjenigen, die auf den Quellen sitzen, entscheidet über Zugang und Preis. Dabei gehören Gesundheitsdaten gar nicht den Systemen, in denen sie gespeichert sind, sondern dem Patienten, den Ärzten, der Solidargemeinschaft der Versicherten, dem Gesundheitswesen. Kein Hersteller sollte das Recht oder die Macht haben, den Zugang zu diesen Daten zu behindern. Ausgerechnet in den USA, denen man ja insbesondere im Gesundheitswesen gerne mal Turbokapitalismus unterstellt, ist man hier ein ganzes Stück weiter. Dort wurde mit dem 21st Century Cures Act von 2016 eine wichtige gesetzliche Grundlage geschaffen, die es Gesundheitsdienstleistern und Softwareherstellern untersagt, Patienten den Zugang zu ihren Gesundheitsdaten zu verweigern. Hierzulande fordert die DSGVO zwar ähnliches, aber weitaus weniger konkret als es in der “Information Blocking”-Richtlinie des Cures Act der Fall ist. (1)
Einen weiteren Grund, weshalb wir in der Gesundheits-IT “mehr Sozialismus wagen” müssen, ist ganz praktischer Natur: Wir stehen bei der Digitalisierung des Gesundheitswesen vor enormen Herausforderungen, die allein mit dem Schreiben neuer Gesetze, Regularien und Spezifikationen nicht gelöst werden können; man muss sie auch implementieren! Und dabei stehen wir sowohl vor dem Problem des Fachkräftemangels in der IT als auch den explodierenden Kosten, die von Softwareherstellern auf die Leistungserbringer, von den Leistungserbringern auf die Kostenträger, von den Kostenträgern auf die Versicherten umgelegt werden. Dabei gibt es in der IT-Branche längst ein etabliertes Prinzip, mit dem gemeinsame Probleme mit gemeinsamer Kraft gelöst werden können: Das Zauberwort heißt “Open Source”. Anstatt dass hunderte von Entwicklern hundert mal dasselbe Problem lösen, können zehn Entwickler das gleiche Problem einmal gemeinsam lösen und allen anderen zur Verfügung stellen.
Das Ergebnis geht schneller, benötigt weniger personelle Ressourcen, verursacht weniger Kosten, liefert eine bessere Softwarequalität und ist robuster als Einzelentwicklungen. Die internationale FHIR-Community macht es vor und liefert einen großen Pool an frei verfügbaren Tools und Bibliotheken. Ich hoffe, dass es uns gelingt, den Solidaritätsgedanken auf die Deutsche Community zu übertragen und den Gesetzgeber dafür zu sensibilisieren, dass die Investition in Open Source-Lösungen einen wichtigen Beitrag leisten kann, die Kosten der Digitalisierung im Griff zu behalten.
(1) www.healthit.gov/topic/information-blocking
Quelle: Krankenhaus-IT Journal