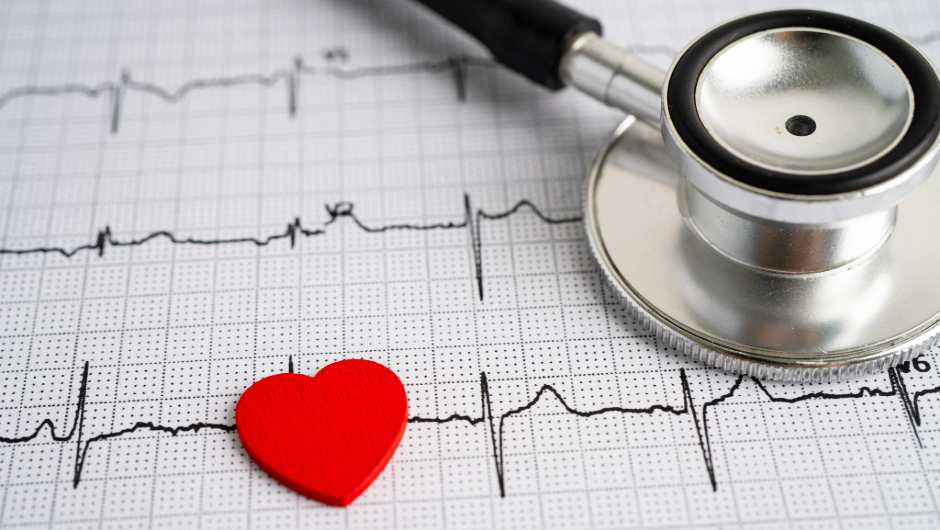Die Diskussion um digitale Souveränität wird schon seit einigen Jahren verstärkt geführt, doch die jüngsten geopolitischen Ereignisse unterstreichen den akuten Handlungsbedarf. Die Technologielandschaft fußt auf Standardisierung, zentralisierten Architekturen, Skaleneffekten und Effizienzgewinnen – ermöglicht durch globalisierte Lieferketten, zentral bereitgestellte Cloud-Services und vielfach auch durch ausgelagerte IT-Leistungen. Dieses Modell hat Innovationskraft freigesetzt und maßgeblich zum wirtschaftlichen Erfolg beigetragen. Doch genau darin liegt ein Dilemma: Erfolgsfaktoren aus den vergangenen 30 Jahren sind Herausforderung und strategisches Risiko.
Digitale Souveränität im Gesundheitswesen bedeutet, dass Institutionen und Einzelpersonen die Kontrolle über ihre digitalen Daten und Prozesse im Gesundheitsbereich behalten und unabhängig von externen Einflüssen agieren können. Es geht nicht darum, isoliert zu sein, sondern vielmehr darum, die eigenen Entscheidungen treffen und die Technologie aktiv gestalten zu können.
Im Gesundheitswesen ist digitale Souveränität besonders wichtig, da sensible Patientendaten geschützt und die Datenverarbeitung sicher und kontrolliert ablaufen müssen. Dies umfasst die Nutzung von Technologien, die den Datenschutz gewährleisten und die Möglichkeit bieten, zwischen verschiedenen Anbietern zu wechseln (Multi-Vendor-Strategien).
Die verschiedenen Arten digitaler Souveränität – insbesondere Daten-, Software- und betriebliche Souveränität – beeinflussen Innovation und Kosten in Kliniken auf unterschiedliche und teils gegensätzliche Weise.
Datensouveränität gewährleistet Kontrolle über Patientendaten und ist essenziell für Datenschutz und Compliance. Sie kann Innovation fördern, wenn Kliniken z. B. anonymisierte Daten für Forschung oder KI-Anwendungen nutzen dürfen. Zu starke Restriktionen hemmen jedoch Innovationspotenziale, da Zugang und Kooperation erschwert werden. Die Einhaltung hoher Souveränitätsstandards kann Investitionen in eigene Infrastruktur erfordern und kurzfristig Kosten erhöhen, langfristig aber Abhängigkeiten und „Hidden Costs“ vermeiden (z. B. durch Exit- oder Migrationsaufwand).
Softwaresouveränität – die Freiheit, Anwendungen unabhängig von einzelnen Anbietern einsetzen und weiterentwickeln zu können – schafft Innovationsspielräume, weil Kliniken flexibler auf neue Anforderungen reagieren können, z. B. durch Open-Source-Lösungen oder modulare Plattformen. Anfangsinvestitionen und der Aufbau eigener Kompetenzen bedeuten aber zunächst höhere Aufwände. Im Gegenzug besteht weniger Risiko eines Vendor-Lock-ins, was künftige Innovationsfähigkeit und Kosteneffizienz sichert.
Betriebliche Souveränität, also die Kontrolle über digitale Abläufe und Infrastruktur, erlaubt es, selbstbestimmt über Einführung und Skalierung innovativer Technologien zu entscheiden. Dies kann zu maßgeschneiderten und effizienteren Lösungen führen, verlangt jedoch hohe Investitionen in Personal und Technik. Gleichzeitig können innovative Ansätze, die durch betriebliche Eigenständigkeit ermöglicht werden, mittelfristig zu Kostenersparnissen (z. B. durch Prozessoptimierung, Automatisierung) beitragen.
Zusammenspiel mit Innovation und Kosten:
- Kliniken mit hoher digitaler Souveränität sind weniger abhängig von Hyperscalern oder proprietären Systemen, können Innovationen besser an lokale Bedürfnisse anpassen und schneller implementieren.
- Hohe Souveränität bewirkt zunächst höhere Kosten durch Eigenentwicklungen oder Investitionen in Datenhoheit, ermöglicht aber nachhaltige Kosteneinsparungen und Effizienzgewinne durch Vermeidung von Lock-in-Effekten und bessere Nutzung von Innovationen.
- Geringe Souveränität etwa durch die Fokussierung auf große Cloudanbieter (Hyperscaler) senkt meist kurzfristig die Kosten (Skaleneffekte, günstige Einstiegspreise), birgt aber Risiken für Innovationsfähigkeit und spätere Kostentreiber (Abhängigkeit, mangelnde Anpassungsfähigkeit).
Eine ausbalancierte Souveränitätsstrategie, individuell abgestimmt auf die jeweilige Klinik und deren Innovationsziele, ist daher zentral, um Innovationschancen aktiv zu nutzen und die Gesamtkostenentwicklung dauerhaft zu steuern.
Von einer ideologisch geführten Diskussion ist abzusehen – Vorstellungen von Digitaler Souveränität mit einer Tendenz von Abschottung bis hin zu Autarkie sind nicht zielführend und verschrecken eher, als dass damit nachhaltige Lösungen und Verbesserungen erzielt werden.
Digitale Souveränität ist nicht gleichbedeutend mit technischer Autarkie – sie bedeutet informierte Entscheidungsfreiheit, Transparenz über digitale Abhängigkeiten, Gestaltungsspielraum bei der Wahl von Technologiepartnern sowie die Fähigkeit, kritische Systeme unabhängig weiterbetreiben zu können. Es geht um Kontrolle und um Resilienz.
Autor:Wolf-Dietrich Lorenz
Foto: Adobe Stock / pek