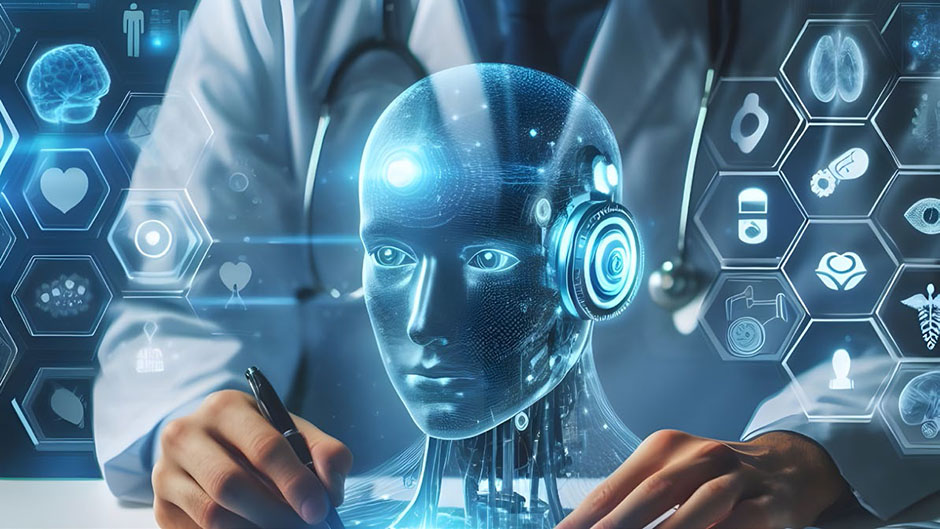Die neue Bundesregierung aus CDU, CSU und SPD hat das Sondervermögen Infrastruktur in Höhe von bis zu 500 Milliarden Euro ins Leben gerufen. Die Gelder sollen auch für die weitere Digitalisierung und die Neugestaltung der Krankenhauslandschaft verwendet werden. Wie viel davon wirklich den Krankenhäusern für die dringend benötigte weitere digitale Transformation zukommt und was die wesentlichen Maßnahmen dabei sind, beschreibt Dr. Uwe Günther, Partner Curacon GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Geschäftsführer Sanovis GmbH, in diesem Beitrag.
Sondervermögen Infrastruktur, Transformationsfonds und Koalitionsvertrag
CDU, CSU und SPD haben sich auf ein Sondervermögen Infrastruktur geeinigt, der Bundestag (mit Beschluss vom 18. März 2025) sowie der Bundesrat (mit Beschluss vom 21. März 2025) haben der Einführung eines neuen Artikels 143h Grundgesetz zugestimmt. Damit wird ein Sondervermögen mit eigener Kreditermächtigung für Investitionen in Infrastruktur in Höhe von bis zu 500 Milliarden Euro geschaffen. In der Formulierung der Einigung von CDU/CSU und SPD heißt es, dass das Sondervermögen für Investitionen in den Bereichen Zivil- und Bevölkerungsschutz, Verkehrsinfrastruktur, Energieinfrastruktur, Bildungs-, Betreuungs- und Wissenschaftsinfrastruktur sowie Forschung und Entwicklung dienen soll.
Das Sondervermögen für die Infrastruktur ist auch im Gesundheitswesen sehr positiv aufgenommen worden. Denn die Gelder sollen außerdem insbesondere für die Digitalisierung und für die Neugestaltung der Krankenhauslandschaft (aufbauend auf der Krankenhausreform) verwendet werden. Dabei fließen 100 Milliarden Euro des Sondervermögens in den „Klima- und Transformationsfonds“. Über Letzteren wird die Modernisierung der Krankenhausstrukturen mit insgesamt bis zu 50 Milliarden Euro gefördert. Einer entsprechenden Rechtsverordnung hat der Bundesrat ebenfalls am 21. März 2025 zugestimmt.
Der Transformationsfonds ist Teil der bereits beschlossenen Krankenhausreform (KHVVG). Auf diese Weise werden die Fördertatbestände des Transformationsfonds konkretisiert und das Verwaltungsverfahren geregelt. Ziel der Verordnung ist, dass Projekte gefördert werden, die eine auf die Leistungsgruppen bezogene Veränderung der stationären Versorgung bewirken und zu konzentrierten, qualitativ hochwertigen stationären Versorgungsstrukturen führen. Eine damit einhergehende Digitalisierung kann unterstellt werden.
Der Transformationsfonds sollte ursprünglich mit Mitteln aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds in Höhe von bis zu 25 Milliarden Euro ausgestattet werden. Um die komplette Summe abzurufen, müssen die Bundesländer ebenfalls 25 Milliarden Euro investieren.
Der am 5. Mai 2025 durch die Regierungsparteien unterzeichnete Koalitionsvertrag besagt allerdings, dass der Bundesanteil des Transformationsfonds nicht aus dem Gesundheitsfonds gespeist werden soll, sondern über das Sondervermögen Infrastruktur: „Wir entwickeln eine qualitative, bedarfsgerechte und praxistaugliche Krankenhauslandschaft aufbauend auf der Krankenhausreform der letzten Legislaturperiode fort und regeln dies gesetzlich bis zum Sommer 2025. […] Die Lücke bei den Sofort-Transformationskosten aus den Jahren 2022 und 2023 sowie den bisher für die GKV vorgesehenen Anteil für den Transformationsfonds für Krankenhäuser finanzieren wir aus dem Sondervermögen Infrastruktur.“ Somit scheint zumindest die Finanzierung der Fortführung der Krankenhausreform gesichert.
Weitere Schwerpunkte im Koalitionsvertrag, die den Krankenhaussektor betreffen, sind die Gesundheitsforschung und zielgruppengerechte Versorgung, der Bürokratieabbau im Gesundheitswesen sowie insbesondere die Digitalisierung. Woher die Gelder für diese Vorhaben kommen sollen, ist dort jedoch nicht explizit geregelt.
Weiterer Finanzierungsbedarf für IT und Digitalisierung in den Krankenhäusern
Die nachhaltige Finanzierung spielt allerdings eine ganz entscheidende Rolle bei der weiteren erforderlichen Digitalisierung des Gesundheitswesens und speziell der Krankenhäuser. Das Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) hat wesentlich dazu beigetragen, die Digitalisierung im Sinne einer Anschubfinanzierung voranzubringen. Langfristig reicht es jedoch nicht aus, um die benötigte digitale Transformation bei den Krankenhäusern sicherzustellen. Ein wesentlicher Umstand dabei ist, dass das KHZG primär einmalige Finanzmittel für Investitionen und Projekte bereitgestellt hat und den wesentlichen Aspekt der nachfolgenden laufenden Betriebskosten zu wenig berücksichtigt. Erschwert wird dieses Defizit durch die Entwicklung, dass moderne IT-Dienstleister zunehmend auf Cloud Computing setzen. Die Kosten dafür müssen ebenfallsdem laufenden Betriebsaufwand zugerechnet werden.
Auch das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz (KHVVG) zielt auf die Verbesserung der Krankenhauslandschaft ab. Es konzentriert sich hingegen stärker auf strukturelle und qualitative Aspekte der Krankenhausversorgung, während das KHZG primär die technologische Modernisierung im Fokus hat. Die Umsetzung der KHVVG-Vorgaben erfordert allerdings moderne vernetzte IT-Systeme. Somit wird deutlich, dass noch kein ganzheitliches Konzept für eine nachhaltige und planbare Finanzierung der IT und der Digitalisierung im Krankenhaus gegeben ist. Dies könnte unter anderem durch eine Integration von ITKosten in das bestehende Krankenhausfinanzierungssystem, insbesondere das DRG-System, erreicht werden. Zukünftige Fördermittel- und Investitionsprogramme, als mögliche Nachfolger des KHZG, müssen berücksichtigen, dass neben den investiven Kostenanteilen auch die langfristigen Betriebskosten, für z. B. zusätzliches IT-Personal, Lizenz- und Wartungskosten, realistisch abbildet werden.
Wesentliche Ansatzpunkte für eine zukunftsgerichtete Krankenhaus-IT
Die Digitalisierung hat viele Bereiche des gesellschaftlichen Lebens und der Wirtschaft bereits stark verändert. Auch für die Gesundheitsversorgung bietet sie große Chancen: nicht nur für schnellere Kommunikation und effizientere Verwaltungsabläufe, sondern insbesondere auch für die Bereitstellung von Patientendaten immer dann und dort, wo sie benötigt werden, als Voraussetzung für eine qualitativ hochwertige, wirksame und menschenzentrierte Behandlung.
Die elektronische Patientenakte, die Kommunikation zwischen Ärzten und Krankenhaus über eine Plattform, die Video-Sprechstunde – das sind nur einige Beispiele für digitale Technologien, die derzeit die deutsche Gesundheitswirtschaft umkrempeln. Basis der Digitalisierung sind die medizinischen Daten, die mittels moderner Informations- und Kommunikationstechnologien zwischen Ärzten und Patienten, aber auch zwischen den einzelnen Leistungserbringern ausgetauscht werden. Die Digitalisierung schafft neue Diagnostik- und Behandlungsmöglichkeiten wie die personalisierte Medizin, sie erleichtert die Kommunikation zwischen den einzelnen Akteuren des Gesundheitswesens und ermöglicht es dem einzelnen Patienten, seine Gesundheit stärker zu steuern, etwa durch Apps und Informationen im Internet.
Was nun sind die großen Herausforderungen, die es konkret in nächster Zeit anzugehen gilt, um eine durchgängige und nutzenbringende Digitalisierung für die Krankenhäuser in Deutschland zu erreichen? Nachfolgend werden die zentralen Ansatzpunkte aufgeführt.
KI als Megatrend
Künstliche Intelligenz (KI) ist eine der Schlüsseltechnologien weltweit und ebenso in Deutschland. Sie bietet scheinbar unbegrenzte Wirtschaftlichkeitspotenziale, auch für eine moderne Gesundheitsversorgung. Dabei ist die KI kein reines Zukunftsthema mehr, sondern bereits heute im klinischen Alltag gegenwärtig bei z. B. Diagnostik, klinischen Entscheidungsunterstützung oder Brief- bzw. Befundschreibung. Allerdings bleibt die Einführung der KI in den Krankenhäusern hinter den Erwartungen zurück. Dies liegt vor allem an der unzureichend ausgeprägten und nicht verknüpften Datenbasis auf Grundlage einer in großen Teilen fragmentierten und schlecht eingeführten Applikationslandschaft.
Eingeschränkte Innovationsfreundlichkeit sowie mangelnde digitale Kompetenz tragen ihr Übriges dazu bei. Es braucht ein ganzheitliches Konzept und mutige Entscheidungen für den nutzbringenden Einsatz von KI.
Systemausbau und Datennutzung
Die Digitalisierung sowie die weitergehende Einführung der KI im Gesundheitswesen steht und fällt, wie oben genannt, mit der Verfügbarkeit und durchgängigen Nutzung von Daten. Um eine solche zu gewährleisten, ist ein vertiefter Ausbau der Funktionalität der bestehenden sowie neuer Anwendungssysteme unabdingbar. Das Krankenhausinformationssystem (KIS) sowie die weiteren klinischen Systeme müssen in Fortführung der Fördertatbestände des KHZG funktional umfassend sowie flächendeckend bereitgestellt werden. Dies gilt zudem für die Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA). Insofern noch nicht geschehen, ist auch die Ertüchtigung der administrativen Applikationen, wie das Finanz- oder Personalsystem, voranzutreiben. Nur so lässt sich eine ganzheitliche und integrative Nutzung der patientenbezogenen und administrativen Daten, z. B. mittels Business Intelligence (BI), sicherstellen.
Interoperabilität und Standards
Die zentrale Voraussetzung für die durchgängige Datennutzung wird durch eine lückenlose Systemintegration und Interoperabilität geschaffen. Nur so können Gesundheitssysteme medizinische Daten ungeachtet des Fachgebiets oder des Softwareanbieters reibungslos austauschen. Hierfür bilden semantische Standards, wie z. B. SNOMED CT und LOINC, sowie technische Standards, wie z. B. von HL7, HL7- FHIR, DICOM und IHE, die Grundlage. Allein die verbindliche Einhaltung dieser Standards ermöglicht die nahtlose Kommunikation innerhalb eines Krankenhauses und darüber hinaus mit anderen Einrichtungen
des Gesundheitswesens.
Personelle Ressourcen
Die digitale Transformation der Krankenhäuser ist nicht primär ein technisches Problem, sie stellt vielmehr eine personelle Herausforderung dar. Spezielles Augenmerk ist dabei auf die Bereitstellung der benötigten personellen Ressourcen zu lenken, was traditionell ein Problem bei den Krankenhäusern darstellt. In Zeiten des digitalen Wandels ist die Einführung einer prozessorientierten IT-Struktur als Vehikel zum besseren Verständnis der Anwender essenziell. In diesem Zuge werden die Unterschiede zwischen Fachbereich und IT zusehends verschwimmen. Dies führt dazu, dass IT- und Fachbereich-Profis gemeinsam an Planung, Entwicklung und Umsetzung von Digitalisierungslösungen arbeiten und entsprechend dafür freigestellt werden müssen. Zudem fungiert die IT zukünftig immer mehr als interne Beratung, als eine Art „Dolmetscher“ zwischen Management, Fachbereichen, Entwicklern und Betreibern.
Cloud Computing und IT-Sicherheit
Die Digitalisierung setzt eine leistungsfähige, stabile und vor allem sichere Systembasis voraus. Für ein einzelnes Krankenhaus wird es immer schwieriger, eine entsprechend hochwertige IT-Infrastruktur mit eigenen Bordmitteln bereitzustellen. Cloud Computing und die Servicemodelle Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), Software as a Service (SaaS) oder Function as a Service (FaaS) werden zunehmend durch die IT-Dienstleister propagiert. Dies führt dazu, dass die Krankenhaus-eigene Systeminfrastruktur in Zukunft an Bedeutung und Ausprägung immer weiter zurückgehen wird. Die zunehmende Digitalisierung und Vernetzung bringen zudem mit sich, dass die IT-Sicherheit entsprechend kontinuierlich zu erhöhen ist.
Fazit und Ausblick
Die Digitalisierung der Krankenhäuser ist seit längerer Zeit voll im Gange, jedoch bei weitem noch nicht abgeschlossen. Dieser langfristige Prozess erfordert eine ebenso langfristige und nachhaltige Finanzierung. Das KHZG hat einen ersten und richtigen Anstoß geleistet, das Sondervermögen Infrastruktur muss diesen nun fortführen. Weitere Finanzierungsmodelle sind vonnöten, die neben den investiven Kostenanteilen auch die langfristigen Betriebskosten der Digitalisierung berücksichtigen. Nur so lassen sich die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen der digitalen Transformation erfolgreich meistern.

Autor: Dr. Uwe Günther, Partner Curacon GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Geschäftsführer Sanovis GmbH
Quelle: Krankenhaus-IT Journal, Ausgabe 03/2025 / Stand Juni 2025