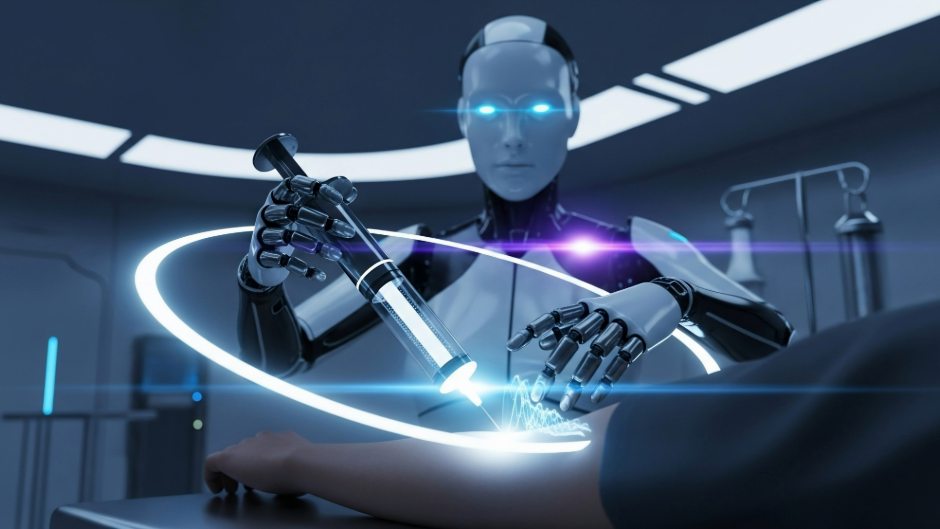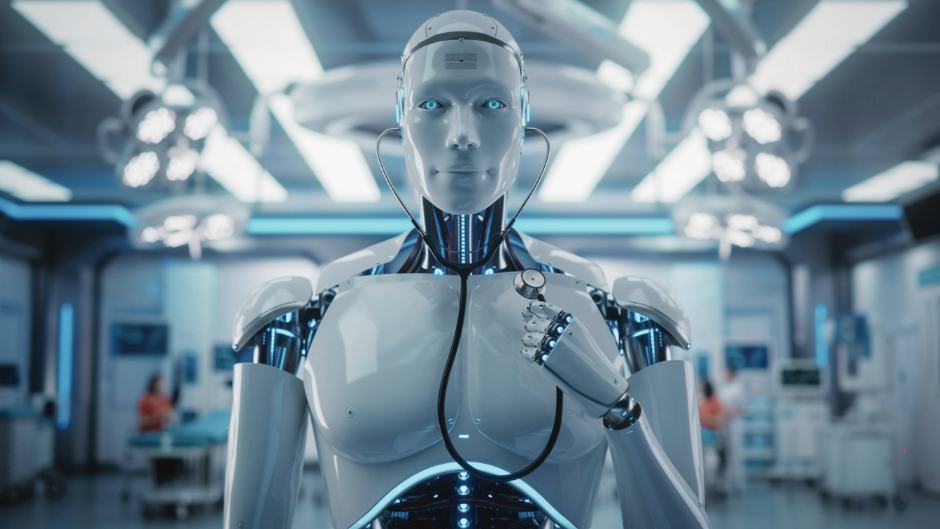Eine erfolgreiche Strategie für die Genommedizin erfordert die enge Verzahnung von spezialisierten Datenbanken, einer effektiven Kommunikation zwischen Krankenhäusern und IT-Abteilungen sowie die konsequente Überwindung bestehender Interoperabilitätslücken. Die fehlende Standardisierung führt dazu, dass moderne IT-gestützte Auswertungen, wie KI-basierte Analysen oder Entscheidungsunterstützungssysteme, nur eingeschränkt möglich sind.
Interoperabilität ist die Fähigkeit, medizinische Daten sektoren- und systemübergreifend auszutauschen. Dies ist im deutschen Gesundheitswesen nach wie vor ein zentrales Problem. Viele Kliniken arbeiten mit Insellösungen, die einen reibungslosen Datenaustausch zwischen Krankenhausinformationssystemen (KIS), Patientenportalen und weiteren Anwendungen verhindern. Dies führt zu Medienbrüchen, doppelten Dateneingaben und einer erhöhten Fehleranfälligkeit, was sowohl die Versorgungsqualität als auch die Effizienz beeinträchtigt.
Datenbanken für die Genommedizin müssen so gestaltet sein, dass sie internationale Standards wie HL7 FHIR, DICOM und IHE unterstützen. Nur so können genetische und klinische Daten sicher und eindeutig zwischen verschiedenen Akteuren – von der Forschung bis zur Versorgung – geteilt werden. Die Medizininformatik-Initiative (MII) zeigt, wie durch standardisierte Schnittstellen und zentrale Plattformen patientenbezogene Daten aus der Routineversorgung für Forschung und individualisierte Therapien nutzbar gemacht werden können.
Kommunikation mit Krankenhäusern und IT sollte auf einer gemeinsamen, interoperablen Infrastruktur basieren. Hierzu zählen die elektronische Patientenakte (ePA), das E-Rezept und sichere Messenger-Dienste, die von der gematik als zentrale Anwendungen entwickelt werden. Dennoch fehlt bislang eine flächendeckend genutzte Plattform, die alle Gesundheitsanbieter – von Kliniken über Praxen bis zu Rehabilitationseinrichtungen – nahtlos einbindet.
Die größten Lücken bestehen bei der Interoperabilität: Unterschiedliche proprietäre Systeme, fehlende verbindliche Standards und eine fragmentierte Förderlandschaft verhindern die sektorenübergreifende Vernetzung. Es braucht klare regulatorische Vorgaben, die alle Beteiligten zur Nutzung einheitlicher Schnittstellen verpflichten, sowie eine nachhaltige finanzielle Förderung der IT-Infrastruktur. Nur durch die Bündelung von Kompetenzen, die Einbindung erfahrener Technologiepartner und eine aktive Steuerung durch die Verantwortungsträger in den Kliniken lässt sich die digitale Transformation der Genommedizin erfolgreich gestalten und die Versorgung der Patient:innen nachhaltig verbessern.
Lücken bei der Integration von Genomdaten in klinische Prozesse
Bei der Integration von Genomdaten in klinische Prozesse bestehen aktuell mehrere zentrale Lücken. Ein wesentliches Problem ist die Komplexität und der Umfang der generierten Daten, insbesondere bei modernen Sequenzierungstechnologien wie WES und WGS.
WES (Whole Exome Sequencing) und WGS (Whole Genome Sequencing) sind Sequenzierungstechnologien, die im Bereich der Genomforschung eingesetzt werden. WGS analysiert die gesamte DNA eines Organismus, während WES sich auf die Exons, also die protein-kodierenden Bereiche des Genoms, konzentriert. WES ist kostengünstiger und liefert oft ausreichend Informationen für die Diagnose genetischer Erkrankungen, während WGS umfassendere Daten für die Forschung und die Entdeckung neuer Varianten bietet.
Diese Daten erfordern fortschrittliche bioinformatische Werkzeuge und multidisziplinäre Expertise, um zwischen klinisch relevanten und irrelevanten Varianten zu unterscheiden und verschiedene Datenebenen sinnvoll zu integrieren. Zudem fehlen umfassende Referenzdaten und standardisierte Prozesse für die Interpretation, was die Nutzbarmachung im klinischen Alltag erschwert.
Ein weiteres Hindernis ist die fehlende Standardisierung der Datenformate und Dokumentationsprozesse. Genomdaten werden oft in unterschiedlichen, teils unstrukturierten Formaten dokumentiert, was die automatisierte Integration in klinische Informationssysteme verhindert und manuelle Übertragungen notwendig macht. Auch die sichere Speicherung und Verarbeitung der sensiblen Daten stellt Kliniken vor technische und organisatorische Herausforderungen, da geeignete Datenverarbeitungsumgebungen erst im Aufbau sind.
Schließlich gibt es Lücken bei der personellen Ausstattung und Expertise: Für die Auswertung und Dokumentation der komplexen Daten sind spezialisierte Fachkräfte wie Humangenetiker:innen und erfahrene Molekularmediziner:innen notwendig, die jedoch vielerorts fehlen. Diese Faktoren führen dazu, dass das volle Potenzial der Genommedizin in der klinischen Versorgung bislang nicht ausgeschöpft werden kann.
Hemmschwellen durch unstandardisierte Bezeichnungen und Dokumentformate
Nicht standardisierte Bezeichnungen und Dokumentformate erschweren den Einsatz genomischer Daten in der Klinik erheblich. Wenn genomische Informationen in uneinheitlichen oder unstrukturierten Formaten – etwa als Freitext, gescannte PDFs oder nicht maschinenlesbare Berichte – vorliegen, können sie nicht automatisiert in klinische Informationssysteme integriert werden. Dies führt dazu, dass relevante Daten nur mit hohem manuellen Aufwand übertragen, verglichen oder ausgewertet werden können. Die Folge sind Medienbrüche, eine erhöhte Fehleranfälligkeit und Verzögerungen im klinischen Entscheidungsprozess.
Zudem verhindern unstandardisierte Bezeichnungen, dass genetische Befunde eindeutig interpretiert und mit anderen klinischen Daten verknüpft werden können. Unterschiedliche Begriffe für identische genetische Varianten oder Diagnosen erschweren die Vergleichbarkeit und Nachvollziehbarkeit von Befunden sowohl innerhalb einer Einrichtung als auch zwischen verschiedenen Krankenhäusern. Dies behindert nicht nur die Versorgung einzelner Patient:innen, sondern auch die Nutzung genomischer Daten für Forschung und Qualitätssicherung.
Aktuell bestehen bei der Integration von Genomdaten in klinische Prozesse mehrere zentrale Optimierungsfelder. Kommunikation mit Krankenhäusern und IT sollte auf einer gemeinsamen, interoperablen Infrastruktur basieren. Hemmschwellen entstehen durch unstandardisierte Bezeichnungen und Dokumentformate beim Einsatz genomischer Daten in der Klinik.
Die fehlende Standardisierung führt außerdem dazu, dass moderne IT-gestützte Auswertungen, wie KI-basierte Analysen oder Entscheidungsunterstützungssysteme, nur eingeschränkt möglich sind, da diese auf strukturierte, interoperable Daten angewiesen sind. Dadurch wird das volle Potenzial der Genommedizin in der klinischen Praxis bislang nicht ausgeschöpft.
Autor: Wolf-Dietrich Lorenz
Foto: Adobe Stock / Corona Borealis