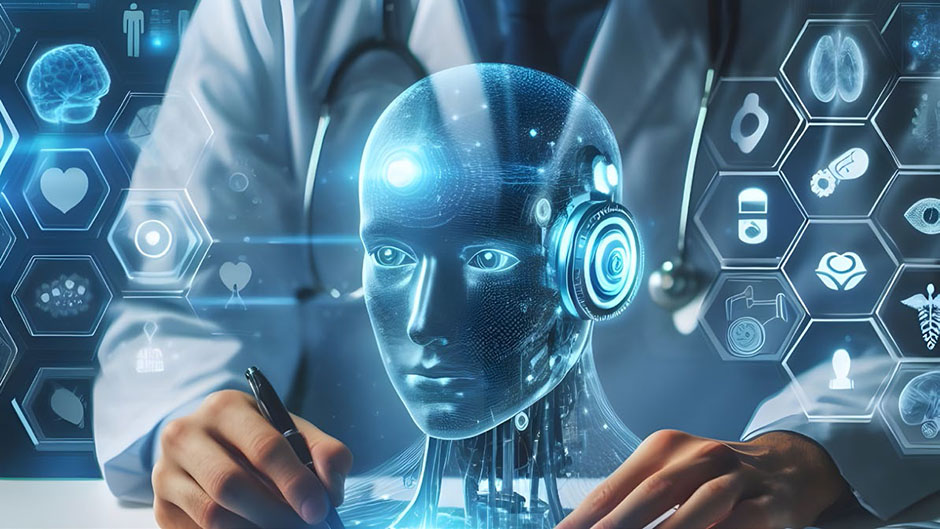Die ambulante Versorgung in Deutschland steht angesichts des demografischen Wandels, eines steigenden Fachkräftemangels und wachsender Patientenzahlen vor drastischen Veränderungen. Der Trend zur Ambulantisierung, also zur Verlagerung medizinischer Leistungen aus dem stationären in den ambulanten Bereich, gilt als Schlüssel zur Bewältigung dieser Aufgaben. Insbesondere für hochaltrige und multimorbide Patientengruppen ist eine stärkere ambulante Versorgung medizinisch sinnvoll, ökonomisch effizient und kann jährlich eine hohe Zahl an Krankenhausaufenthalten vermeiden.
Die Digitalisierung verändert die ambulante Versorgung bereits tiefgreifend. Rund ein Drittel der deutschen Ärztinnen und Ärzte setzt heute Künstliche Intelligenz (KI) ein, vor allem in der Bildgebung, Diagnostik und Dokumentation. KI-Anwendungen ermöglichen präzisere Diagnosen, verkürzen Wartezeiten und unterstützen bei der Priorisierung von Patientenfällen. Sie entlasten medizinisches Personal, indem sie Routinetätigkeiten automatisieren und so mehr Zeit für die direkte Patientenversorgung schaffen. Die Mehrheit der Ärzteschaft sieht in KI eine entscheidende Zukunftstechnologie für eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung.
Telemedizin und digitale Hilfsmittel
Telemedizinische Angebote wie Videosprechstunden, Telekonsile und Telemonitoring sind zentrale digitale Hilfsmittel, die insbesondere die Versorgung in ländlichen Regionen verbessern. Sie ermöglichen einen schnellen, sektorenübergreifenden Austausch von Expertise, verkürzen Diagnosezeiten und sparen Patienten lange Anfahrtswege. Die digitale Vernetzung von Praxen, Kliniken und weiteren Leistungserbringern steigert die Effizienz und Qualität der Versorgung, wobei der Schutz sensibler Gesundheitsdaten höchste Priorität behält.
Tech-Giganten auf dem deutschen Gesundheitsmarkt
Die Marktmacht von Tech-Konzernen kann dazu führen, dass kleinere Unternehmen und Start-ups aus dem Gesundheitsmarkt verdrängt werden. Zudem verstärkt sich die Kommerzialisierung des Gesundheitswesens. Die Fokussierung auf datenbasierte Geschäftsmodelle könnte dazu führen, dass das Gesundheitswesen stärker kommerzialisiert wird und weniger auf dem Solidaritätsprinzip basiert. Eines der führenden E-Health-Unternehmen Europas Doctolib verzeichnet mit 25 Millionen registrierten Patienten einen Rekordzuwachs an registrierten Patienten und Gesundheitsfachkräften. Das Unternehmen plant weitere Investitionen in KI-basierte Lösungen für die Patientenversorgung, sichere Kommunikationslösungen für medizinisches Fachpersonal, innovative Praxisverwaltungssoftware (Launch in Q4 2025) und weitere Expansion in neue europäische Märkte.
Internationale Tech-Unternehmen wie Google, Amazon oder Microsoft drängen verstärkt auf den deutschen Gesundheitsmarkt, insbesondere im Bereich digitaler Gesundheitsanwendungen und Cloud-Infrastrukturen. Sie bieten innovative Plattformen für Terminmanagement, elektronische Patientenakten oder KI-gestützte Diagnostik. Während diese Entwicklungen das Innovationspotenzial erhöhen, warnen Fachleute vor einer zu starken Abhängigkeit von kommerziellen Anbietern und betonen die Notwendigkeit, Datenschutz, Interoperabilität und die ärztliche Verantwortung im Blick zu behalten. Der Einfluss von KI wird auf Therapieentscheidungen zunehmen. Immer mehr Patienten werden Daten zu ihrem Gesundheitszustand digital dokumentieren. Sie könnten diese ihren Krankenkassen zur Verfügung stellen, um bessere Konditionen zu erhalten. Das Marktvolumen für Gesundheits-, Diagnose- und Selbstüberwachungs-Apps soll in den kommenden Jahren auf über 16 Milliarden Euro ansteigen.
Digitalisierung und KI als Treiber der Transformation
Die Digitalisierung verändert die ambulante Versorgung grundlegend, indem sie Abläufe effizienter gestaltet, die Kommunikation zwischen Leistungserbringern verbessert und den Zugang zu Telemedizin ermöglicht. Die ambulante Versorgung in Deutschland befindet sich im Umbruch: Digitalisierung, KI und Telemedizin bieten große Chancen, die Versorgungsqualität zu steigern und dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Digitale Anwendungen und KI helfen nicht nur bei der Behandlung, sondern auch in der Prävention: Gesundheits-Apps, Wearables und automatisierte Analyse-Tools fördern einen gesünderen Lebensstil und unterstützen die Früherkennung von Krankheiten. Gleichzeitig gilt es, die Integration neuer Technologien verantwortungsvoll zu gestalten und die Balance zwischen Innovation und Patientenschutz zu wahren. Die Rolle der Tech-Giganten bleibt dabei ambivalent und erfordert eine kritische Begleitung durch Politik und Selbstverwaltung des Gesundheitswesens.
Autor: Wolf-Dietrich Lorenz
Foto: Adobe Stock / wladimir1804