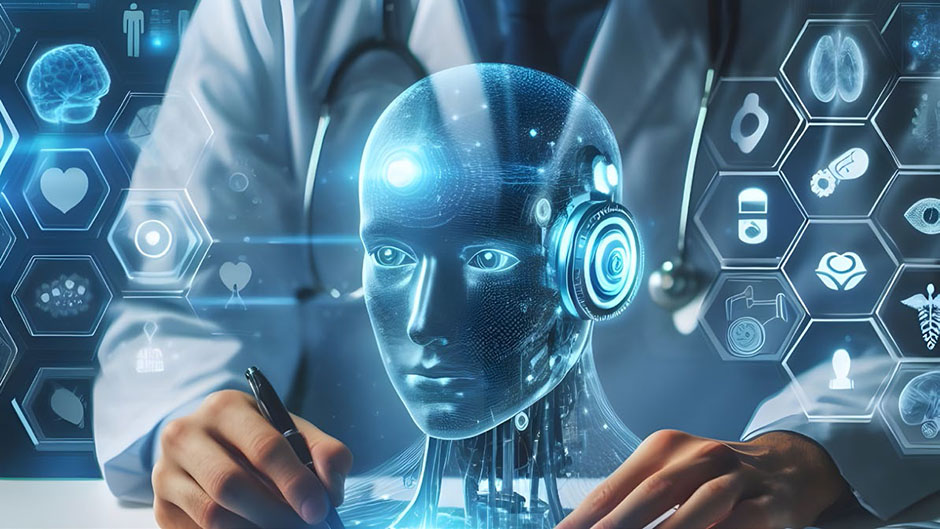Vom Bremer Rathaus in die Werkstatt der digitalen Medizin: Fraunhofer MEVIS feierte Jubiläum – und blickte auf die Medizin von morgen - In diesem Jahr wird das Fraunhofer-Institut für Digitale Medizin MEVIS 30 Jahre alt – und feierte das am 3. und 4. September mit mehreren Veranstaltungen. Bei einem Festakt im Bremer Rathaus würdigten Vertreter:innen aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft die Rolle des Instituts als Pionier der digitalen Medizin und Taktgeber für die Gesundheitsversorgung vom morgen. Auf einem international besetzten Symposium boten renommierte Fachleute einen Ausblick in die Zukunft der Medizin. Anschließend öffnete das Institut seine Türen für die Öffentlichkeit: Beim Open House machten Fraunhofer MEVIS-Mitarbeitende mit zahlreichen, teils interaktiven Demos ihre aktuellen Forschungsprojekte erlebbar.
Foto: Institutsleiter Prof. Horst Hahn begrüßt die Gäste anlässlich der 30-Jahr-Feier des Fraunhofer MEVIS im Bremer Historischen Rathaus. © Fraunhofer MEVIS
Die Geschichte des Forschungszentrums MEVIS begann in den neunziger Jahren mit einer ungewöhnlichen Idee durch den Gründer und langjährigen Institutsleiter Prof. Heinz-Otto Peitgen: Mathematik und Informatik sollten der Medizin neue Impulse verleihen und beispielsweise helfen, Operationen präziser und schonender zu machen. »Das war ein Abenteuer, ein Wagnis ohne Vorbild«, erzählte Peitgen auf der Festveranstaltung im Rathaus. »Ich war naiv, ich hatte keine Ahnung, was es heißt, sich in die Medizin einzumischen«.
Das erste Projekt nutzte Methoden der fraktalen Geometrie, um Leberoperationen besser planen zu können. In enger Zusammenarbeit mit dem Radiologen Prof. Klaus Jochen Klose in Marburg wurde dazu eine eigene Software für die Leber-OP-Planung entwickelt. Der Durchbruch gelang, als der japanische Chirurg Prof. Koichi Tanaka – damals der weltweit führende Spezialist für Leberlebendtransplantationen – Anfang der 2000er Jahre die Bremer Technologie übernahm. »Ohne diese frühen Schritte«, so Peitgen, »gäbe es Fraunhofer MEVIS heute nicht.«
Würdigung durch Politik und Wirtschaft
Heute ist das Institut längst international etabliert. »Fraunhofer MEVIS ist eine feste Größe in der Bremer Wissenschaftslandschaft und ein echter Keyplayer, wenn es um den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Gesundheit und der intelligenten Krebstherapie geht«, sagt Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte in einer Videobotschaft. »MEVIS kann mit Recht stolz auf 30 Jahre Pionierarbeit in der digitalen Medizin zurückblicken.«
»Das Institut fungiert als Schnittstelle zwischen Medizin und Informatik«, betonte Dr. Sandra Krey, Vorständin der Fraunhofer-Gesellschaft. »Seine Arbeit ist nicht nur technologisch anspruchsvoll, sondern von enormer gesellschaftlicher Bedeutung.« Und: »Was Fraunhofer MEVIS auszeichnet, ist die besondere Fähigkeit, Medizin, Technik und Informatik zu verbinden«, sagte Prof. Christiane Kuhl, die Präsidentin der Deutschen Röntgengesellschaft. »Diese Brücke ist für die Radiologie besonders wichtig«.
Die enge Partnerschaft mit der Universität Bremen hob Rektorin Prof. Jutta Günther hervor. Sie betonte, dass die digitale Medizin ein wichtiges Thema in den Exzellenzbestrebungen der Bremer Hochschulen sei. Und: »Für viele Menschen macht es heute einen Unterschied, ob es die Forschung bei Fraunhofer MEVIS gegeben hat oder nicht.« Auch die Industrie profitiert bereits seit langem von Kooperationen mit dem Institut. Walter Märzendorfer, langjähriger Manager bei Siemens Healthineers, erinnerte an die gemeinsame Weiterentwicklung der Mammographie-Technik: »Plötzlich hatten wir ein akademisch geprägtes Institut, das mitentwickeln wollte. Das war etwas völlig Neues, aber es hat sich bewährt«. Dass sich Fraunhofer MEVIS von Beginn an nicht nur als Forschungsstätte verstand, sondern auch als Innovationsmotor, machte André Grobien, Präses der Handelskammer Bremen, deutlich: »Fraunhofer MEVIS hat in Bremen den Boden für eine herausragende Start-up-Kultur geebnet. Es trägt entscheidend dazu bei, dass Bremen für Startups ein attraktiver Ort ist«. Über Ausgründungen wie MeVis Medical Solutions AG und Techsomed sind bis heute mehr als 100 Arbeitsplätze in der Hansestadt entstanden.
Kritischer Blick aufs Gesundheitssystem
Doch die Festveranstaltung warf auch kritische Fragen auf. So beklagte Prof. Gerhard Hindricks, Direktor der Kardiologie am Deutschen Herzzentrum der Charité, die zu starke Fokussierung des deutschen Gesundheitswesens auf eine »Reparaturmedizin« und die Vernachlässigung von Prävention und Bildung. »Die Digitalisierung ist der größte Hebel der Geschichte, Medizin besser zu machen«, so Hindricks. »Unter anderem bietet sie die Chance, einen gerechteren Zugang zur Medizin für unterversorgte Gebiete zu erlauben.« Wenn er einen Wunsch frei hätte, dann die Einführung des Pflichtfachs „Gesundheit“, damit bereits in der Schule Grundlagen für ein gesundes Leben gelegt werden.
Neben der Digitalisierung sieht Prof. Horst Hahn, Leiter des Fraunhofer MEVIS, besonders in der Verwendung leistungsfähiger KI-Produkte erhebliche Chancen: »Die KI ist ein Werkzeug, das zum Beispiel Behandlungserfolge detailliert messbar machen kann – da steckt ein Riesenpotenzial drin«. Unter anderem ließen sich dadurch unnötige Behandlungen früher erkennen und abbrechen – zum Wohle von Patentinnen und Patienten und zugute der strapazierten Gesundheitskassen
KI als Ermöglicher?
Der zweite Veranstaltungstag war der Zukunft gewidmet: Internationale Fachleute diskutierten auf dem Symposium im Institutsgebäude, das auch Werkstatt der Digitalen Medizin genannt wird, darüber, welche Rollen KI, Big Data und neue, verbesserte Bildgebungsverfahren in den kommenden Jahren spielen werden. »In der Radiologie wird KI bisher vor allem für einzelne, begrenzte Aufgaben eingesetzt, etwa für die Priorisierung der Versorgung von Patient:innen mit potentiell lebensbedrohlichen Befunden und zunehmend für die Quantifizierung von Bildinhalten«, erklärte der angehende Vorsitzende der amerikanischen Fachgesellschaft für Radiologie (American College of Radiology) Prof. Christoph Wald von der Mayo Clinic in den USA. So könne KI zum Beispiel die Dicke der Hirnrinde bestimmen oder den Grad einer Lungenerkrankung erfassen – Aufgaben, die für Radiolog:innen in der Routineversorgung händisch zu zeitaufwendig wären.
Die Zukunft sieht er darin, etwa mit sogenannten multimodalen Foundation Models aus Bilddaten automatisch Entwürfe für Befundberichte erstellen zu können. Aber: »Der Mensch muss unbedingt in der Verantwortung bleiben«, so Wald. »Für die Behandelten ist es entscheidend, dass eine ausgebildete Person die endgültige Diagnose stellt.« KI werde die tägliche Arbeit effizienter machen, etwa indem sie unauffällige Röntgenbilder verlässlich vorsortiert und damit die Radiolog:innen entlastet. Zudem könnten KI-Systeme Abläufe und Kommunikation optimieren – von der Terminplanung über die Auslastung der Geräte bis hin zum Patient:innenfluss. Wald: »So schaffen wir es, Zugangshürden abzubauen und Wartezeiten zu verringern. Von entscheidender Bedeutung wird es außerdem sein, dass KI zukünftig Radiologinnen und Radiologen sowohl bei der Zusammenfassung von komplexen bereits existierenden Patientendaten aus der Krankenakte als auch bei der Anwendung von relevanten Klassifizierung- und Behandlungsschemata assistiert.«
Mammographie-Screening effizienter machen
Prof. Nico Karssemeijer von der Radboud-Universität Nijmegen stellte dar, wie KI das Mammographie-Screening revolutioniert. Derzeit werden in vielen Ländern die Röntgenbilder von zwei Fachleuten unabhängig begutachtet, um die Befundqualität, also die Richtigkeit der Bildbeurteilung, abzusichern. KI könnte hier einen Teil der Arbeit übernehmen und diese Doppelbefundung ersetzen. »Das entlastet die Fachleute und verbessert zugleich die Qualität, mit weniger Fehlalarmen und mehr erkannten Tumoren“, so Karssemeijer. Zudem versprechen lernfähige Algorithmen auch eine personalisierte Früherkennung: Frauen mit erhöhtem Risiko könnten intensiver untersucht werden, während andere seltener zur Mammographie müssten. Neue Methoden wie kontrastverstärkte Mammographie oder Brust-MRT ließen sich so gezielt und effizient einsetzen.
Dagegen gibt es bei der Prostatakrebsdiagnostik bislang kein flächendeckendes Screening-Programm. Der häufig eingesetzte PSA-Test kann zwar ein Hinweis auf ein Tumor sein, führt aber wegen seiner Ungenauigkeit vermehrt zu Überdiagnosen und unnötigen Eingriffen. Hier setzt KI an: In Kombination mit einer MRT kann sie Fehldiagnosen und überflüssige Biopsien drastisch reduzieren. »Wenn wir den PSA-Tests eine KI-Risikovorhersage vorschalten, können wir die Zahl an unnötigen Biopsien um etwa 40 Prozent reduzieren«, so Prof. Martin Eklund vom Karolinska-Institut in Stockholm. »Und mit dem Einsatz von MR-Scannern und KI-Werkzeugen lässt sich die Zahl an Überdiagnosen um fast 70 Prozent vermindern – das sind fantastische Zahlen«. Langfristig könnten KI-Systeme direkt vorhersagen, welche Therapie für einen Patienten am besten geeignet ist. Damit ließen sich Übertherapien und Nebenwirkungen verringern und die Lebensqualität der Betroffenen verbessern.
Einblicke für die Öffentlichkeit
Auch bei der Behandlung von Lebertumoren bringen KI-Algorithmen die Medizin voran. In der Leberchirurgie erstellen sie 3D-Modelle, in denen Gefäße, Tumoren und Organstrukturen sichtbar werden. Dadurch lassen sich Operationen präzise und schnell planen. »Mit KI-Unterstützung können wir Prozesse, die zuvor Stunden gedauert haben, in einem Bruchteil der Zeit erledigen«, so Prof. Andrea Schenk, stellvertretende Institutsleiterin des Fraunhofer MEVIS. »Dadurch werden Operationen möglich, die früher nicht machbar waren.« Für die Zukunft erwartet sie KI-Systeme, die Patient:innen nicht nur zu einem Zeitpunkt begleiten, sondern den gesamten Krankheitsverlauf abbilden. Ziel sei es, Therapien vorherzusagen, Behandlungsfortschritte zu überwachen und Biomarker automatisch zu identifizieren. »Eine Herausforderung vor allem in Deutschland ist allerdings der Zugang zu den Daten«, so Schenk. »In vielen Krankenhäusern sind die Daten nicht digital oder strukturiert verfügbar, das ist nach wie vor ein Problem.«
Beim Open House am Donnerstagnachmittag konnte die Öffentlichkeit dann die Forschung von Fraunhofer MEVIS direkt erleben – etwa die Präsentation von Prof. Anja Hennemuth. Sie zeigte eine interaktive Plattform, die Menschen unterstützt, denen eine Operation bevorsteht. Realisiert ist das KI-gestützte System bedienungsfreundlich auf einem Tablet. Dort lässt sich per Schieberegler einstellen, dass das Körpergewicht um ein paar Kilos fällt oder der Blutdruck auf einen geringeren Wert sinkt. Daraufhin zeigt das Gerät, um wie viel das persönliche Operationsrisiko durch diese Maßnahmen sinkt – was die Menschen zu einer achtsameren Lebensweise vor der OP motivieren soll. »Das Besondere daran ist: Es ist interaktiv.«, so Hennemuth. »Mit Hilfe ihres ›digitalen Zwillings‹ sehen die Betroffenen sofort, wie sie ihr eigenes Risiko beeinflussen können.«
Bild & Quelle: Fraunhofer-Institut für Digitale Medizin MEVIS