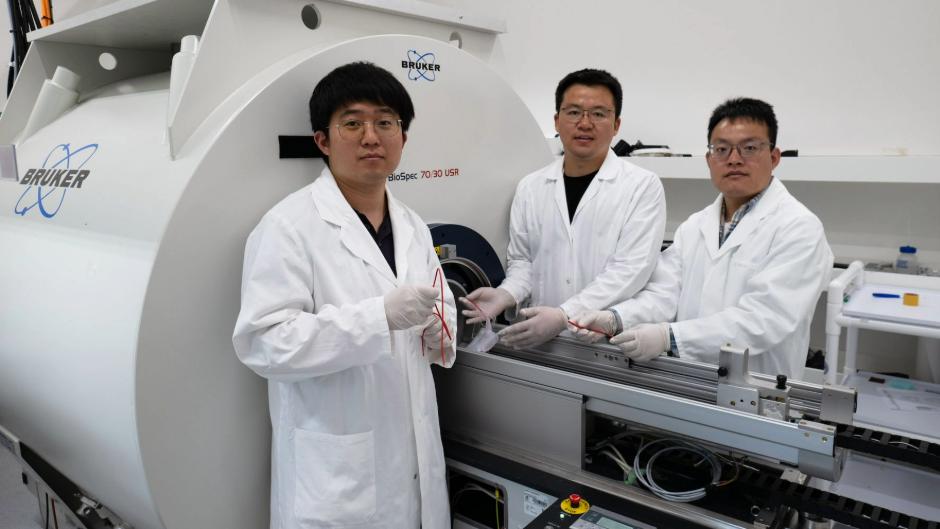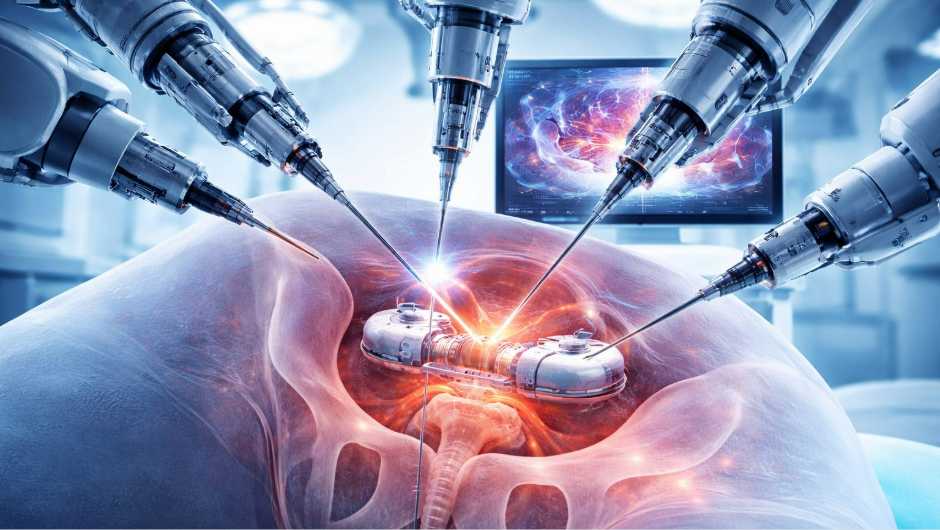In einer in Nature veröffentlichten Arbeit stellen Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Intelligente Systeme in Stuttgart eine Methode vor, mit der sie einen Stapel magnetischer Röhren in Echtzeit und vor Ort neu programmieren können. Durch die Neuanordnung und Neukombination der magnetischen Einheiten jeder Röhre erlangt der puppenartige Roboter beispiellose Formwandlungsfähigkeiten und eröffnet damit neue Möglichkeiten für Softroboter. Solche Roboter könnten für eine Vielzahl von Anwendungen, unter anderem in der Medizintechnik, eingesetzt werden.
Foto: Von links nach rechts: Fan Wang, Xianqiang Bao und Jianhua Zhang.
Bisher waren die Magnetisierungsprofile magnetischer Roboter in der Regel fest vorgegeben und ermöglichten nur eine bestimmte Formprogrammierung durch externe Magnetfelder. Forscher am Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme (MPI-IS) haben nun eine neue Methode zur Magnetisierungsreprogrammierung vorgeschlagen, die die Komplexität und Vielfalt der Formprogrammierungsmöglichkeiten solcher Roboter drastisch erweitern kann. Sie bauten einen Softroboter, dessen Magnetisierungsprofil in Echtzeit und vor Ort verändert werden kann. Ihre Ergebnisse wurden am 11. September 2025 in Nature veröffentlicht.

Abbildung 1: Darstellung der Echtzeit-In-situ-Magnetisierungs-Reprogrammierungsmethode. (A) Verschachtelung mehrerer Röhren mit magnetischen Einheiten zu einer integrierten Röhre; (B) Erweiterung der Anzahl magnetischer Einheiten in einer einzelnen Röhre; (C) Magnetisierungsprofil variiert mit der Rekonfiguration mehrerer Röhren. (D–G) Verformung unter einem konstanten Magnetfeld: (D, E) eindimensional; (F) zweidimensional; (G) dreidimensional. Der Röhrendurchmesser beträgt in Abb. 1D 1,9 mm und in Abb. 1E 2,6 mm.
Unter der Leitung von Prof. Dr. Metin Sitti in der Abteilung für Physische Intelligenz (PI) am MPI-IS in Zusammenarbeit mit der Koç-Universität in Istanbul, Türkei, stapelte das Team mehrere Röhren wie Matrjoschka-Puppen ineinander. Wie in Abbildung 1A zu sehen ist, ist Röhre C in Röhre B eingebettet, die wiederum in Röhre A eingebettet ist.
Jedes Rohr enthält eine oder mehrere Magneteinheiten, deren Magnetisierungsprofil bei Bedarf vorprogrammiert werden kann (Abbildung 1B). Ändert sich die Stapelkonfiguration der Rohre durch eine andere nichtmagnetische Betätigungsmethode, beispielsweise durch Auseinander- oder Zusammenschieben der Rohre, ändert sich die relative Position der Magneteinheiten und damit das Magnetisierungsprofil des gesamten Stapels (Abbildung 1C).
Diese Echtzeit-Erzeugung und -Transformation von Formen vor Ort war mit bisherigen magnetischen Robotern nicht möglich. Bei konstantem Magnetfeld kann sich ein Rohr nun jedoch von einer geraden Linie in eine Helix verwandeln (Abbildung 1D) oder sich in die entgegengesetzte Richtung verformen (Abbildung 1E). Darüber hinaus lässt sich dieser Ansatz auf zwei- und dreidimensionale Gerüste erweitern, wodurch ein Echtzeit-Umschalten zwischen mehreren Verformungsmodi ohne Änderung des Magnetfelds möglich ist (Abbildungen 1F und 1G).
Während der Schwerpunkt an den Max-Planck-Instituten in erster Linie auf der von Neugier getriebenen Grundlagenforschung liegt, hat das Team auch untersucht, wie diese Methode in verschiedenen Szenarien angewendet werden könnte, beispielsweise bei der Navigation um Objekte herum ohne unerwünschten Kontakt, bei der Neuprogrammierung von Zilien-Arrays und bei der Koordination mehrerer Instrumente, entweder gemeinsam oder unabhängig voneinander unter demselben Magnetfeld.
Doch die Forschung könnte eines Tages auch praktische Anwendung finden. Zum Beispiel in der Medizin – insbesondere bei minimalinvasiven, bildgesteuerten Behandlungen von Gefäßerkrankungen. Dabei führen Ärzte einen Katheter samt Führungsdraht durch die Blutgefäße bis zur Zielläsion, um sie zu diagnostizieren oder zu behandeln. Da der Katheter gekrümmte Gefäße passiert, sind Reibung und Kontakt mit der Gefäßwand unvermeidlich. Dies kann zu Schäden führen, die die Genesung verzögern und in schweren Fällen zu medizinischen Komplikationen führen. Vor allem ältere Patienten entscheiden sich oft gegen solche Eingriffe und stattdessen für Medikamente.
Die neue Technologie, die nun in Nature veröffentlicht wurde, bietet eine überzeugende Alternative: Durch die Echtzeit-Anpassung des Magnetisierungsprofils des Katheters an den vorausliegenden Katheterverlauf könnten Reibung und Kontakt beim Navigieren durch gekrümmte Gefäße deutlich reduziert oder sogar ganz vermieden werden. Dies würde Schäden an empfindlichem Gewebe minimieren, eine schnellere Genesung fördern und Gefäßeingriffe für Patienten zu einer sinnvollen Option machen, die sonst aufgrund ihres Alters oder der Fragilität ihrer Gefäße von diesen Verfahren ausgeschlossen wären.
„Dieser Schlauchstapel könnte in Zukunft zum Leitprinzip einer neuen Kathetertechnologie werden. Obwohl es sich hier um Grundlagenforschung handelt, sehen wir großes Potenzial für die Umsetzung dieser Arbeit in verschiedene reale Anwendungen in naher Zukunft“, sagt Sitti, ehemaliger Leiter der PI-Abteilung am MPI-IS und heute Präsident der Koç-Universität in Istanbul.
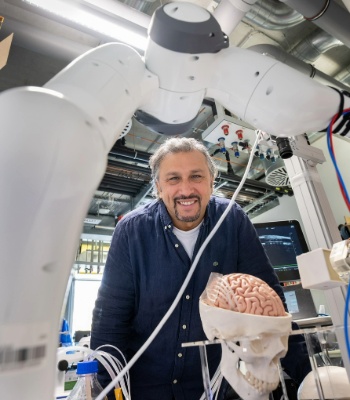
Foto: Prof. Metin Sitti
„Unser ursprüngliches Ziel war es, eine Methode zu entwickeln, mit der sich ein Magnetisierungsprofil in Echtzeit und vor Ort verändern lässt“, sagt Xianqiang Bao, Erstautor der Veröffentlichung. „Im Laufe unserer Forschung entdeckten wir unerwartete Fähigkeiten wie Formbeständigkeit und magnetische Neutralisierung, die neue Möglichkeiten für Technologien wie Katheterdesign und die Neuprogrammierung von Zilien-Arrays eröffnen.“
„Diese grundlegende Arbeit bietet viele potenzielle Anwendungsszenarien. In unserer zukünftigen Forschung wollen wir diese Methode in konkrete Anwendungen integrieren und ihre Machbarkeit in anderen Bereichen untersuchen“, sagen Fan Wang und Jianhua Zhang, die beiden weiteren Co-Erstautoren der Veröffentlichung.
Referenz:
Bao, X., Wang, F., Zhang, J. et al. Echtzeit-In-situ-Magnetisierungs-Reprogrammierung für Softrobotik. Nature 645, 375–384 (2025).
https://doi.org/10.1038/s41586-025-09459-0
Bilder: Quelle: Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme